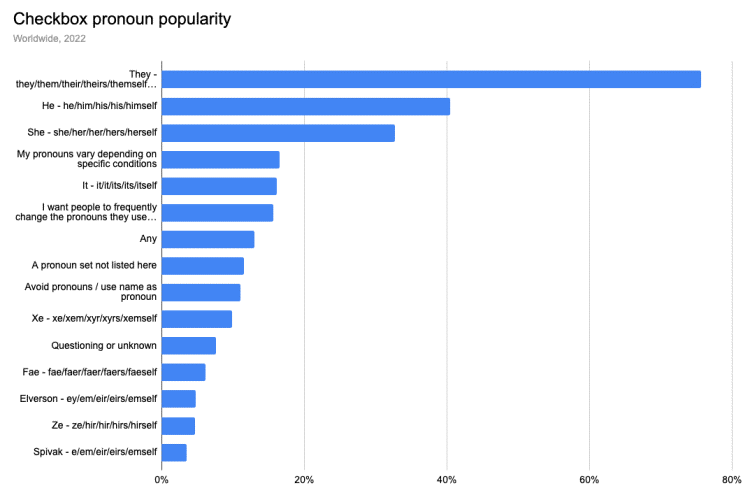Miroslav Imbrišević

Der Philosoph Uwe Steinhoff (Hong Kong) trotzt schon seit Jahren der Gender-Ideologie. In einem Artikel von 2022 bezeichnet er Dana Mahr, eine Transfrau, als Mann und benutzt männlichen Pronomen [hier]. Mahr schickte Steinhoff daraufhin diesbezüglich eine Abmahnung. Gegen diese Abmahnung hat Steinhoff eine negative Feststellungsklage eingelegt. Eine solche Klage bittet das Gericht darum, festzustellen, dass die Abmahnung grundlos ist. Das Gericht hat diese negative Feststellungsklage abgewiesen, es findet die Abmahnung also für berechtigt. Steinhoff hat sich jetzt dazu geäußert [hier] und geht mit den Richtern streng ins Gericht. Kollege Steinhoff hat meiner Ansicht nach Recht; die Richter sind juristisch nicht auf der Höhe. Ich greife nur einige Gesichtspunkte aus dem Urteil auf.
Sprachgebrauch
Die Richter meinen: „Soweit der Kläger ins Feld führt, dass der allgemeine Sprachgebrauch heranzuziehen [Steinhoff bezieht sich auf die Definitionen im Duden] sei in dem Sinne, dass ein biologischer Mann ein Mann sei, ist dem entgegen zu halten, dass der allgemeine Sprachgebrauch eine Transfrau nicht als Mann bezeichnet.“ So einfach ist die Sache nicht. Es ist bekannt, dass der Durchschnittsbürger von der Terminolgie überfordert ist, denn er hält eine Transfrau für eine Frau, die glaubt, ein Mann zu sein – und umgekehrt.
Sprachgeschichtlich gesehen, fand eine Umkehrung der Begriffe statt (ca seit Anfang der 90er Jahre). Früher hätte man von transsexuellen Männer gesprochen für Personen, die heute als „Transfrau“ bezeichnet werden. Es handelt sich hier also um einen bloßen Ettikettenschwindel. Hätte man die alte Terminologie beibehalten, dann wären viele der heutigen Probleme gar nicht entstanden. Ein transsexueller Mann, bzw. ein ‚Transmann‘ wäre dann, jemand der biologisch männlich ist, sich aber als ‚Frau‘ fühlt. Und eine ‚Transfrau‘ wäre eine biologische Frau, die sich für einen Mann hält. Dann wäre das Mantra ‚Transfrauen sind Frauen‘ sogar wahr. Und niemand käme auf den Gedanken, es auf Plakate zu schreiben und immer wieder zu intonieren, denn es wäre ja selbstverständlich. Der heutige Sprachgebrauch der trans Ünterstützer ist im wahrsten Sinne des Wortes nicht ‚selbstverständlich‘.
Die rechtliche Fiktion
Was die Richter nicht bedenken, ist, dass wir es mit einer rechtlichen Fiktion (fictio legis) zu tun haben. Rechtliche Fiktionen sind streng genommen Unwahrheiten. Sie werden geschaffen, um ein gesellschaftspolitisches Ziel zu fördern. Dies spiegelt sich in der juristischen Maxime wider: fictio legis neminem laedit – eine rechtliche Fiktion schadet niemandem. Folglich lässt das Gesetz (oder ein Gericht) Aussagen zu, die schlichtweg falsch sind. Aber alle Beteiligten (der Gesetzgeber, Anwälte und Richter) wissen das. Die rechtliche Fiktion findet sich bereits im römischen Recht (siehe die Lex Cornelia, 81 v. Chr), aber wir finden sie auch im Common Law und in den euroäischen Rechtssystemen. Wenn der Staat eine rechtliche Fiktion schafft, wird das normalerweise nicht explizit gemacht (wohl wegen der oben erwähnten Maxime). Man fügt also einem solchen Gesetz normalerweise nicht hinzu: „Aber dies ist eine rechtliche Fiktion“. Der ‚als-ob‘-Charakter der rechtlichen Fiktion wird aber in seltenen Fällen deutlich. Hier ein Beispiel aus dem englischen Recht, wo die Bezeichnung für das rechtliche Instrument spechend ist, nämlich bei der Einholung einer „Erklärung des mutmaßlichen Todes“ [„declaration of presumed death“] für einen lange vermissten Angehörigen. Man kann diesen Angehörigen als für tot erklären, obwohl er, ohne, dass wir das wußten, in Acapulco am Strand sitzt und Margaritas trinkt. Baroness O’Cathain hat 2003 während der Debatte des Transgender-Gesetzesentwurfs im Oberhaus (House of Lords) deutlich gemacht, dass damit eine rechtliche Fiktion geschaffen wird.
Einige Rechtssysteme haben jedoch – in weiser Voraussicht – Ausnahmen in ihre Transgender-Gesetze eingebaut (das Vereinigte Königreich und Australien): z. B. können Transfrauen von Sportwettbewerben für Frauen ausgeschlossen werden. Die Gesetzgeber hatten vorausgesehen, dass die rechtliche Fiktion in diesem Fall die Rechte anderer verletzen oder ihnen Schaden zufügen könnte. Abgesehen von ihrer Schutzfunktion erinnern uns diese Ausnahmen auch daran, dass wir es mit einer rechtlichen Fiktion zu tun haben.
Rechtliche Fiktionen haben ihrem Wesen nach einen engen Anwendungsbereich. Sie gelten in mancher Hinsicht, aber nicht in jeder Hinsicht: Ein Unternehmen, d. h. ‚eine juristische Person‘ ist in Wirklichkeit keine Person, und kann folglich auch nicht heiraten; die Sommer-/Winterzeit (wie der Name schon sagt) ist auf bestimmte Daten beschränkt, usw.
Wenn Transfrauen wirklich in jeder Hinsicht „Frauen“ wären, dann wäre die im britischen Gesetz festgelegte unterschiedliche Behandlung ein Verstoß gegen die Gerechtigkeit. Bei Gesetzen, die keine Ausnahmen vorsehen, werden manch naive Zeitgenossen dazu verführt, an die Fiktion zu glauben. In einem Interview von 2019 behauptete Rachel McKinnon (jetzt ‘Veronica Ivy’): ‚I am legally and medically female’.
In Deutschland gilt z.Z. noch das alte Transsexuellengesetz (TSG) von 1981, das neue SBG tritt erst ab dem 1. November 2024 in Kraft. D.h., die Richter des Landgerichts Bielefeld mußten sich an das noch bestehende, alte, Gesetz halten.
Im TSG heißt es: ‚Voraussetzung für die Änderung der Vornamen [‚kleine Lösung‘] ist, dass der Antragsteller sich dem anderen Geschlecht als zugehörig empfindet und seit mindestens drei Jahren unter dem Zwang steht, seinen Vorstellungen entsprechend zu leben.‘ Hier wird deutlich, dass die Subjektivität (‘empfindet’, ‘seinen Vorstellungen entsprechend’) der Person Vorrang vor objektiven Tatsachen hat.
Laut §8 sollten, unter anderem, folgende Vorraussetzungen erfüllt sein:
Die Person hat ‚sich einem ihre äußeren Geschlechtsmerkmale verändernden operativen Eingriff unterzogen (…), durch den eine deutliche Annäherung an das Erscheinungsbild des anderen Geschlechts erreicht worden ist‘ [2011 vom BFG gekippt].
Der Gesetzgeber ging also davon aus, dass der Transsexuelle im Regelfall das Erscheinungsbild des anderen Geschlechts nicht erfüllt und sich dem aber durch eine geschlechtsangleichende Operation ‚annähern‘ kann. Das drückt aus, dass das biologische Geschlecht sich vom gewünschten unterscheidet. Biologisch gesehen ist eine Transfrau also keine Frau; dies trifft nur im beschränkt rechtlichen Sinne zu.
Leider hat das Bundesverfassungsgericht die begriffliche Klarheit, die uns die Naturwissenschaften bieten, zerstört: ‚Es ist wissenschaftlich gesicherte Erkenntnis, dass die Zugehörigkeit eines Menschen zu einem Geschlecht nicht allein nach den äußerlichen Geschlechtsmerkmalen im Zeitpunkt seiner Geburt bestimmt werden kann, sondern sie wesentlich auch von seiner psychischen Konstitution und selbstempfundenen Geschlechtlichkeit abhängt.‘ Das BFG vermischt hier das biologische Geschlecht (schon vor der Geburt feststellbar) mit der sogenannten Geschlechtsidentität, die sich im Laufe der Zeit entwickelt. Witzigerweise hält selbst Judith Butler (die Patentante des körperlosen Geschlechts) die Geschlechtsidentität für eine Illusion (Gender Trouble 1990: 185f.): ‘acts and gestures, articulated and enacted desires create the illusion of an interior and organizing gender core, an illusion discursively maintained for the purposes of the regulation of sexuality within the obligatory frame of reproductive heterosexuality.’
Normalerweise fallen biologisches Geschlecht und soziale Rolle zusammen; bei trangender Personen ist das nicht so. Wichtig ist aber, dass die Geschlechtsidentität (z.B. Transfrau) das biologische Geschlecht (männlich) nicht ändern kann. Wenn man also sagt, Transfrauen sind biologisch gesehen männlich, dann ist das richtig. Dass Transfrauen eine weibliche Geschlechtsidentität (was immer das auch bedeutet) geltend machen, kann für die Mitbürger, vor allem für Frauen und Mädchen, negative Auswirkungen haben. Man denke an Sexualstraftäter, die darauf drängen, in Frauengefängnissen untergebracht zu werden, oder an Transfrauen, die bei sportlichen Wettkämpfen gegen Frauen antreten wollen.
Der gesunde Menschenverstand lehrt uns aber etwas anderes. Wenn eine Transfrau an Prostatakrebs erleidet, dann kann der Onkologe nicht sagen: „Aber Sie sind doch, laut Geschlechteintrag, eine Frau. Wir können Sie nicht behandeln.“ Man beachte auch wie realitätsnah der Gesetzgeber ist, wenn es um Kinder geht. Transfrauen, die ein Kind zeugen, bleiben ‚Väter‘, und Transmänner die ein Kind zur Welt bringen, bleiben ‚Mütter‘. Hier werden die ‚Rechte‘ von transgender Personen beschnitten, zum Wohle des Kindes, dem man keine zwei Mütter oder zwei Väter zumuten möchte. Das Recht kann also sehr wohl zwischen Transfrauen und Frauen unterscheiden. Das kommende SBG tut dies auch – es gibt ‚Sonderregeln‘, also Ausnahmen.
Dort heißt es: „Für bestimmte Lebensbereiche sieht der Gesetzentwurf klarstellende Regeln und/oder Sonderregeln vor. Diese Regeln betreffen insbesondere: (1) Quotenregelungen; (2) den Zugang zu Einrichtungen und geschützten Räumen sowie die Teilnahme an Veranstaltungen; (3) die Bewertung von sportlichen Leistungen; (4) medizinische Behandlungen; (5) den Spannungs- und Verteidigungsfall; (6) das Eltern-Kind-Verhältnis.“
Im Kriegsfall wissen wir also, wer Frau und wer Mann ist. Da können Transfrauen nachträglich zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden. All dies verdeutlicht, dass der Gesetzgeber weiß, dass er eine rechtliche Fiktion geschaffen hat und dass Transfrauen im Kriegsfall ‚Männer‘ sind. Die Geschlechtsidentität spielt jetzt keine Rolle mehr; es geht nur um den Körper (bzw. die körperliche Leistungsfähigkeit von biologischen Männern).
Diese Sonderregeln/Ausnahmen sind den Transaktivisten (auch in GB) ein Dorn im Auge, denn damit kann man auch dem verbohrtesten Ideologen klarmachen, dass wir es mit einer rechtlichen Fiktion zu tun haben. Demnach sind also Transfrauen nur in einem eng beschränkten, juristischen, Sinn Frauen (z.B. auf der Geburtsurkunde, im Reisepass, etc.), sonst aber Männer. Das Gesetz, behandelt Transfrauen als wären (Konjunktiv!) sie Frauen – sie sind es aber nicht wirklich.